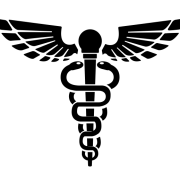Ärztliche Dokumentationspflicht und die Beweisregeln des § 630h BGB in der anwaltlichen Praxis.
Die Dokumentationspflicht des Arztes wird im § 630h III BGB geregelt:
- Hat der behandelnde Arzt eine medizinisch gebotene wesentliche Maßnahme und ihr Ergebnis
- entgegen § 630f Abs. 1 oder Abs. 2 nicht in der Patientenakte aufgezeichnet oder
- hat er die Patientenakte entgegen § 630f Abs. 3 nicht aufbewahrt,
- wird vermutet, dass er diese Maßnahme nicht getroffen hat.
Aus dem Grundsatz der Waffengleichheit folgt, dass der Arzt seinem Patienten Aufschluss über sein Vorgehen in dem Umfang geben muss, in dem ihm das ohne weiteres möglich ist. Dem genügt der Arzt durch Vorlage einer ordnungsgemäßen Dokumentation im Operationsbericht, Krankenblatt oder in der Patientenkarte.
Eine aus medizinischer Sicht nicht erforderliche Dokumentation ist auch aus rechtlicher Sicht nicht geboten, weil ihr Ziel nicht darin besteht, für einen späteren Haftungsprozess des Patienten Beweise zu sichern.
Nach § 630f Abs. I S.1 BGB ist der Behandelnde verpflichtet zum Zweck der Dokumentation in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Behandlung eine Patientenakte in Papierform oder elektronisch zu führen.
Die Dokumentation ist eine Nebenpflicht des Behandlungsvertrages, wobei ihre Verletzung keine eigenständige Haftungsgrundlage für einen Behandlungsfehler ist (vgl. BGH NJW 1995, 1611).
Eintragungen sind sofort oder zeitnah zu erledigen, um inhaltliche Fehler durch Zeitablauf zu vermeiden. Änderungen von Einträgen sind nur zulässig, wenn neben dem ursprünglichen Inhalt erkennbar bleibt, wann sie vorgenommen wurden.
Nach § 630f Abs. III BGB hat der Behandelnde die Patientenakte für die Dauer von 10 Jahren nach Abschluss der Behandlung aufzubewahren, sofern sich nicht nach anderen Vorschriften anderen Aufbewahrungsfristen ergeben.
Bei Verstößen gegen die obigen Ausführungen besteht zugunsten des Patienten die Vermutung, dass nicht eingetragene, dokumentationspflichtige Maßnahmen und Behandlungen usw. nicht durchgeführt wurden.
Hiergegen besteht seitens des Arztes die Möglichkeit diese Vermutung durch den Beweis des Gegenteils nach § 292 ZPO zu entkräften.
Bei einer unterlassenen Dokumentation muss ein Gerichtsgutachter aussagen, dass es sich bei dem fehlenden Eintrag um eine dokumentationspflichtige Maßnahme handelt.
Oft scheuen sich Gutachter jedoch diese Fehler direkt zu benennen. So gibt es Äußerungen im Sinne von: „Es gibt keine Vorschriften, wie ein Operationsbericht abzufassen ist. Manche Ärzte schreiben länger, manche kürzer, beides ist richtig.“
Bei einer unrichtigen Dokumentation muss der Patient zunächst Zweifel an der ordnungsgemäßen Dokumentation darlegen und beweisen, z.B. durch ein medizinisches gerichtlich beauftragtes Gutachten.
Wenn der Gutachter eine Dokumentation als „lückenhaft“ bezeichnet, lässt das den Rückschluss zu, dass dokumentationspflichtige Angaben darin fehlen. Dann muss der Arzt beweisen, woraus sich z.B. ein lückenhafter Operationsbericht rechtfertigen soll. Gelingt ihm der Beweis nicht, greift die Vermutung, was nicht dokumentiert ist, wurde nicht gemacht. Dies kann mitunter der Vermutung eines Behandlungsfehlers entsprechen. Die Behandlerseite kann das Gegenteil beweisen.
Indizien für eine unrichtige Dokumentation können dabei sein, anderer Stift oder andere Farbe, andere Handschrift oder Einfügungen an unpassenden Stellen.
(vgl. insgesamt ZMGR, 2017, 237 – 241)
Insgesamt ist festzustellen, dass es in arzthaftungsrechtlichen Verfahren sowohl auf Seiten des Arztes als auch auf Seiten des Patienten oft auf die Frage der Beweisbarkeit ankommt.
Dabei ist es gerade für den Patienten in vielen Fällen nicht erkennbar, ob ein relevanter Dokumentationsmangel vorliegt.
Unser Fachanwalt für Medizinrecht Joachim Schmidt berät sowohl Ärzte als auch Patienten gerne rund um das Thema Dokumentations- und Behandlungsfehler, deren Vermeidbarkeit und Aufklärung.
Aachen, im Januar 2018
Matthias Draheim
Rechtsanwalt